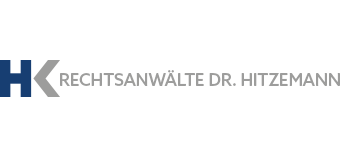Die Zahlung von Unterhaltsvorschuss nach dem Unterhaltsvorschussgesetz gibt es in der BRD seit 1980 als Sozialleistung ( vgl. Wikipedia).
Der Anspruch steht Elternteilen zu, bei denen die Kinder leben und die vom anderen Elternteil keinen oder nur geringfügigen Unterhalt erhalten.
Voraussetzung ist, dass der jeweilige Vater oder die jeweilige Mutter alleinerziehend ist. § 1 Abs. 1 Nr. 2 UVG regelt, dass das Kind nur „bei einem seiner Elternteile lebt“. Sinn und Zweck des Gesetzes ist, denjenigen Elternteil zu entlasten, der „wegen des Ausfalls des anderen Elternteils besonders belastet“ ist. Eindeutig ist die Vorschrift anzuwenden, wenn das Kind lediglich bei einem Elternteil lebt.
Es gibt hingegen auch Sachverhalte, in denen sich getrenntlebende Eltern die Betreuung des gemeinsamen Kindes/ der gemeinsamen Kinder aufteilen. Gerade in der Vergangenheit hat sich das sog. Wechselmodell etabliert, im Rahmen dessen beide Elternteile die gemeinsamen Kinder betreuen. Das Bundesverwaltungsgericht hat geurteilt, dass ein vollständiges Alleinerziehen nicht Voraussetzung für die Anwendung der Vorschrift ist. Elternteilen droht auch dann eine besondere Belastung, wenn der Schwerpunkt der Betreuung ganz überwiegend bei diesem Elternteil liegt ( Bundesverfassungsgericht Urteil vom 12.12.2023 – 5 C 9/22 und 5 C 10/22).
Teilen sich die getrenntlebenden Eltern die Betreuung des gemeinsamen Kindes auf und verlangt ein Elternteil Unterhaltsvorschuss, so gilt dieser als alleinerziehend, wenn er mehr als 60 % der Betreuung übernimmt. Damit ist eine quantitative Grenze festgelegt, ab der ein Elternteil als alleinerziehend gilt und die Rechtswohltat der Vorschrift für sich in Anspruch nehmen kann. Liegt also der Mitbetreuungsanteil des anderen Elternteils bei 40 % oder
mehr, gibt es keinen Unterhaltsvorschuss.